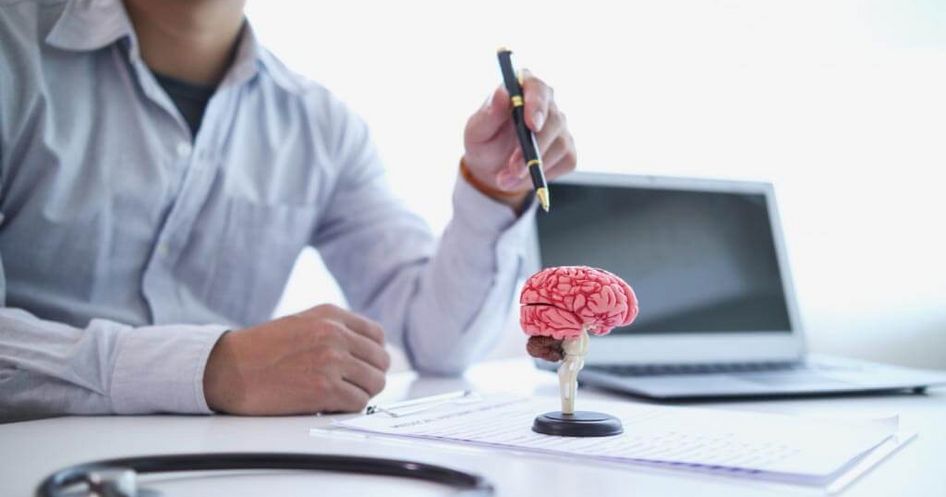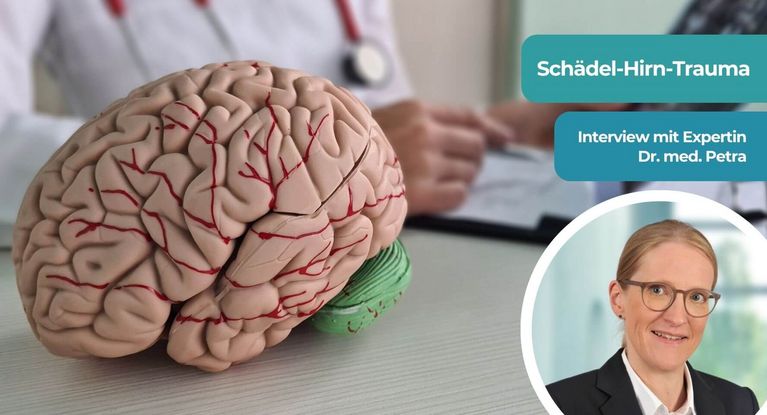Ein Schädel-Hirn-Trauma kann das Gehirn dauerhaft schädigen und Betroffene entsprechend beeinträchtigen. Erfahren Sie, wie es entsteht, welche Symptome auftreten können und wie Ärzt*innen es diagnostizieren und behandeln. Lesen Sie außerdem, welche Folgen möglich sind und wie eine gezielte neurologische Rehabilitation dabei hilft, Fähigkeiten zurückzugewinnen und Schritt für Schritt wieder am Alltag teilzuhaben.
Was ist ein Schädel-Hirn-Trauma?
Der Begriff Schädel-Hirn Trauma (Abkürzung SHT) steht für eine Kopfverletzung, bei der das Gehirn betroffen ist. Die Verletzungen bei einem SHT reichen von leichten Gehirnerschütterungen bis hin zu massiven Schädelbrüchen mit schweren Schädigungen des Gehirns. Die allgemeine Ursache für eine Schädel-Hirn-Verletzung ist eine Gewalteinwirkung auf den Kopf, meist infolge eines Unfalls im Straßenverkehr, eines Sturzes oder eines Schlages auf den Kopf.
Wie gefährlich ist ein Schädel-Hirn-Trauma?
Wie gefährlich ein Schädel-Hirn-Trauma ist, hängt davon ab, wie schwer der knöcherne Schädel und das Gehirn verletzt sind und welche Beeinträchtigungen die Hirnverletzungen verursachen. Der Begriff Schädel-Hirn-Trauma umfasst sowohl eine harmlose Beule mit einer leichten Funktionsstörung des Gehirns als auch schwerste Verletzungen des Kopfes, die zu bleibenden Behinderungen führen oder tödlich enden können.
Bei einer geschlossenen Kopfverletzung sind die Schädelknochen und die harte Hirnhaut intakt.
Von einem offenen Schädel-Hirn-Trauma spricht man, wenn der Schädelknochen und die darunter liegende harte Hirnhaut durchbrochen sind.
Welche Komplikationen können nach einem Schädel-Hirn-Trauma auftreten?
Nach einem Schädel-Hirn-Trauma können vielfältige Komplikationen auftreten:
- Schwellungen des Gehirns
- erhöhter Hirndruck
- Blutungen
- Durchblutungsstörungen
- mangelhafte Sauerstoffversorgung des Gehirns
- Entzündungen
- Epilepsie
- Lähmungen und Spastik
- Wahrnehmungsstörungen
- kognitive Störungen
- Persönlichkeitsveränderungen
- Wachkoma
Komplikationen gefährden die Genesung, können gravierende Spätfolgen haben und zum Tod führen. Bei der Diagnostik und der Behandlung einer Schädel-Hirn-Verletzung versuchen die Ärzt*innen Komplikationen schnellstmöglich zu entdecken und ihnen entgegenzuwirken.
Wie häufig kommt ein Schädel-Hirn Trauma vor?
In Deutschland erleiden jährlich etwa 300 von 100.000 Menschen ein Schädel-Hirn-Trauma. Schätzungsweise 7,7 Millionen Menschen leben in der Europäischen Union mit den Folgen einer Schädel-Hirn-Verletzung.
Welche Arten von Schädel-Hirn-Traumata gibt es?
Man unterscheidet folgende Arten von Schädel-Hirn-Traumata:
Einteilung nach Schweregrad:
- Leichtes Schädel-Hirn-Trauma (Gehirnerschütterung): Es liegt keine dauerhafte Schädigung vor.
- Mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma (Gehirnprellung): Hierbei liegt eine offene oder geschlossene Schädigung der Hirnsubstanz vor
- Schweres Schädel-Hirn-Trauma (Gehirnquetschung): Hierbei ist das Gehirn durch erhöhten Hirndruck oder äußeren Druck geschädigt.
Zusätzliche Einteilung der Verletzungen:
Schädelbrüche: Brüche der Schädelkalotte oder der Schädelbasis
Fokale intrakranielle Läsionen: Schädigungen, die auf einen bestimmten Bereich begrenzt sind
Nach einem Schädel-Hirn-Trauma kann sich Blut an verschiedenen Stellen im Kopf sammeln. Ein Hämatom ist eine Ansammlung von Blut im Gewebe.
- Epidurales Hämatom: Hier fließt Blut zwischen den Schädelknochen und der harten Hirnhaut (Dura mater).
- Subdurales Hämatom: Das Blut sammelt sich unter der harten Hirnhaut. Es gibt eine akute Form, die sofort Beschwerden macht, und eine chronische Form, die sich langsam entwickelt.
- Subarachnoidalblutung: Das Blut liegt zwischen zwei weiteren Hirnhäuten, der Arachnoidea und der Pia mater.
- Intrazerebrales Hämatom: Hier entsteht die Blutung direkt im Gewebe des Gehirns.
Die Stelle, an der sich das Blut sammelt, bestimmt, welche Symptome auftreten und welche Behandlung nötig ist.
Diffuse intrakranielle Läsionen: ausgedehnte Schädigungen im Gehirn
- Ödem: Schwellung des Gehirns
- Kontusionsblutung: Blutungen im Gehirngewebe
- Diffuse axonale Schädigung (DAS): Verletzung der Nervenfasern, die sich diffus im Gehirn verteilen
Ursachen für ein Schädel-Hirn-Trauma
Ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) entsteht nach einer Krafteinwirkung am Kopf. Häufige Ursachen für ein SHT sind:
- Stürze
- Verkehrsunfälle
- Sportunfälle
- Arbeitsunfälle
- Körperverletzungen
Risikogruppen
Kleinkinder, junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und30 Jahren und ältere Personen erleiden häufiger ein Schädel-Hirn-Trauma als andere Altersgruppen.
- Das spezielle Risiko für eine Schädel-Hirn-Trauma bei Kleinkindern und älteren Personen ist erhöht, weil diese beiden Altersgruppen häufiger stürzen und sich im Sturz schlechter abfangen können als ältere Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene.
- Junge Erwachsenen haben ein höheres Risiko für Kopfverletzungen, weil sie im Alltag im Durchschnitt aktiver sind als andere Altersgruppen und daher auch öfter Unfälle erleiden.
- Ein Risiko für schwere Schädel-Hirn-Traumata haben Menschen mit Blutungsneigung, weil bei ihnen auch leichte Kopfverletzungen gefährliche Hirnblutungen auslösen können.
Welche Symptome treten bei einem Schädel-Hirn-Trauma auf?
- Bei einem Schädel-Hirn-Trauma treten allgemeine Symptome auf, die den Bewusstseinszustand und die Hirnfunktion betreffen:
- Patient*innen mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma erscheinen unmittelbar nach der Verletzung verwirrt und können sich nicht daran erinnern, was sich kurz vor der Verletzung ereignet hat (retrograde Amnesie).
- Ein mittelschweres bis schweres Schädel-Hirn-Trauma führt zunächst zu Bewusstlosigkeit. In schweren Fällen können die Patient*innen in ein Koma fallen.
- Krampfanfälle innerhalb der ersten Stunde oder des ersten Tages nach dem Trauma sind möglich.
- Nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit sind einige Patient*innen wieder völlig klar. Bei anderen sind Bewusstsein und Hirnfunktion gestört. Die Bewusstseinsstörungen reichen von leichter Verwirrtheit bis zu einem Zustand völliger Erstarrung bei wachem Bewusstsein (Stupor).
- Je nach Art, Ort und Ausmaß der Hirnverletzungen zeigen die Patient*innen unterschiedliche Beeinträchtigungen: wie z. B. Lähmungen, Koordinationsstörungen, Sprachprobleme und/oder Wahrnehmungsstörungen.
- Es können auch Störungen wichtiger Körperfunktionen wie z. B. Kreislaufstörungen, Probleme mit dem Blutdruck, Atemstörungen oder Nierenprobleme auftreten.
Luzides Intervall – scheinbare Erholung nach Kopfverletzung
Wenn sich Patient*innen mit Hirnverletzungen nach dem Aufwachen zunächst erholen, sich ihr Zustand jedoch bald darauf wieder verschlechtert, nennt man die scheinbare Erholungsphase „luzides Intervall“. Die Ursachen für die Verschlechterung können Blutungen, zunehmender Hirndruck, Entzündungsprozesse oder andere fortschreitende Schäden im Gehirn sein.
Spezielle Symptome bei verschiedenen Arten von Schädel-Hirn-Trauma
Einige Symptome nach einem Schädel-Hirn-Trauma können Hinweise darauf geben, unter welcher Art von Kopfverletzung der oder die Betroffene leidet.
Symptome bei Gehirnerschütterung
- Übelkeit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Gedächtnisstörungen
- Konzentrationsprobleme
- Benommenheit
Symptome bei Epiduralhämatomen
- zunehmende Kopfschmerzen
- Bewusstseinstrübung bis hin zu Koma
- Übelkeit und Erbrechen
- Unruhe oder Verwirrtheit
- Epileptische Anfälle
Symptome bei akuten subduralen Hämatomen
- Orientierungsstörungen
- Bewusstseinsstörungen
- Denkstörungen
- erhöhter Hirndruck
- Kopfschmerzen
- Krampfanfälle
- Lähmungen
- asymmetrische Pupillen
- Übelkeit und Erbrechen
Symptome bei chronischen subduralen Hämatomen
- Kopfschmerzen
- Benommenheit und Müdigkeit
- Lähmungserscheinungen
- neurologische Ausfallerscheinungen (z. B. Sehstörungen, Denkstörungen, Sprachprobleme, Taubheitsgefühle)
Symptome bei intrazerebralen Hämatomen und Hirnprellungen
- Lähmungen
- akute einsetzende Kopfschmerzen
- Bewusstseinsstörungen
- Übelkeit und Erbrechen
Verletzungen bestimmter Gehirnregionen können den Blutdruck erhöhen sowie Herz und Nieren schaden. Es kommt zu Symptomen wie
- Bluthochdruck
- Herzrasen
- Herzmuskelstörungen
- Durchblutungsstörungen im Herz
- Herzschmerzen
- Nierenschädigung
- Verschlechterung der Nierenfunktion
Symptome bei erhöhtem Hirndruck
- Erbrechen
- Sehstörungen
- Bewusstseinsstörungen
- Bluthochdruck
- verlangsamte Herzfrequenz
- langsame unregelmäßige Atmung
Symptome bei Schädelbasisbruch
- Austritt von klarer Flüssigkeit (Liquor) aus der Nase und/oder Rachen
- Riss des Trommelfells
- flächige Einblutungen in die Haut („Blutflecken“) hinter den Ohren oder um die Augen
- Verlust des Geruchsinns und des Gehörs
- Lähmungen der Gesichtsmuskulatur
- Empfindungsstörungen im Gesicht
- Schmerzen
- Bewusstseinsstörungen
Wie wird ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt?
Ein Schädel-Hirn-Trauma muss schnellstmöglich diagnostiziert und behandelt werden, weil unbehandelte Hirnverletzungen zu schweren Komplikationen führen können. Diese Komplikationen können lebensbedrohlich sein, das Gehirn zusätzlich schwer schädigen und die Folgeschäden verschlimmern.
Zu den ersten Untersuchungen gehören:
- erste schnelle Beurteilung der Verletzung
- Klärung des Bewusstseinszustands (Bewusstlosigkeit/Bewusstseinsstörungen)
- Überprüfung von Atmung und Kreislauf
- klinische neurologische Untersuchung (Neuro-Status)
Schweregrad eines Schädel-Hirn-Traumas
Der Schweregrad eines Schädel-Hirn-Traumas wird im Rahmen der Erstuntersuchung mit der Glasgow Koma Skala (GCS) geschätzt.
Die Glasgow Koma Skala beurteilt die Bewusstseinslage, die Orientiertheit, das Sprech- und Sprachvermögen und die motorische Reaktion des*r Verletzten. Der niedrigste Punktwert auf der GCS beträgt 3 der höchste 15 Punkte.
Von einem schweren Schädel-Hirn-Trauma (SHT) spricht man, wenn der Wert auf der Glasgow Coma Scale (GCS) zwischen 3 und 8 liegt. Ein mittelschweres (moderates) Trauma liegt bei 9 bis 12 Punkten vor. Bei 13 bis 15 Punkten handelt es sich um ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Bei den meisten Schädel-Hirn-Traumata handelt es sich um leichte Verletzungen, nur in etwa 3% der Fälle liegt ein mittelschweres, in 5% ein schweres SHT vor.
Weitere Diagnostik nach der Erstuntersuchung
Die weiteren Untersuchungen werden parallel zur stabilisierenden und lebenserhaltenden Behandlung durchgeführt.
Zu weiteren Diagnostik gehören:
- Wiederholte neurologische Untersuchungen, um Verschlechterungen schnell zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Verbesserungen oder Verschlechterungen geben auch Hinweise auf die Schwere der Verletzungen und die Prognose.
- Bei einem Schädel-Hirn-Träume wird in der Regel eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Auf den CT-Aufnahmen lassen sich Verletzungen der Kopfknochen, Blutungen und bestimmte Schädigungen des Gehirns meist gut erkennen.
- Bei Bedarf kommt anschließend die Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz, die Verletzungen des Gehirns detaillierter als die CT darstellt.
- Blutuntersuchungen ergänzen diese Untersuchungen.
Wie wird ein Schädel-Hirn-Trauma behandelt?
In der Akuttherapie werden die Betroffenen stabilisiert, die Verletzung wird versorgt und die Komplikationen und unmittelbaren Folgen des Schädel-Hirn-Traumas behandelt.
Die Folgen eines Schädel-Hirntraumas werden in der Rehabilitation gezielt behandelt. Oft beginnt die Frührehabilitation schon im Akutkrankenhaus. Sie hilft dabei, Einschränkungen und Behinderungen nach der Gehirnverletzung schneller zu mindern und die Erholung zu unterstützen.

Behandlung direkt nach dem Unfall bzw. der Verletzung (Akuttherapie)
Die Therapie richtet sich nach der Schwere der Verletzungen und nach den Symptomen der Patient*innen.
Schonung bei leichten Verletzungen
Bei einem leichten Schädel-Hirn-Trauma ohne neurologische Symptome genügt es oft, sich für einige Tage zu schonen.
Wichtig ist, dass Patient*innen mit einer leichten Hirnverletzung in den ersten 24 Stunden nach dem Ereignis überwacht werden, weil es auch bei leichten Formen einer Schädel-Hirn-Verletzung zu Komplikationen kommen kann, die ärztlich behandelt werden müssen.
Mittelschwere oder schwere Schädel-Hirn-Traumata
Patient*innen mit mittelschwerem und schweren Schädel-Hirn-Traumata werden stationär neurologisch überwacht oder intensivmedizinisch betreut. Koma-Patient*innen müssen z. T. künstlich beatmet und ernährt werden. In bestimmten Fällen müssen die Patient*innen operiert werden.
In welchen Fällen muss operiert werden?
- Verletzungen der Knochen von Schädel, Schädelbasis oder Gesicht werden operativ behandelt.
- Wenn Blutungen im Kopf auf das Gehirn drücken, werden sie ggf. chirurgisch entfernt.
- Operationen sind auch erforderlich, wenn der Hirndruck ansteigt und nicht durch andere Maßnahmen gesenkt werden kann.
Medikamentöse Therapien
Ein Schädel-Hirn-Trauma kann vielfältige neurologische und allgemeinmedizinische Folgen haben, die medikamentös behandelt werden.
Hierzu gehören unter anderem:
- Infektionen
- Krampfanfälle
- Herz-Kreislauf-Probleme
- Funktionsstörungen der Nieren
- Schmerzen
Frührehabilitation nach einem Schädel-Hirn-Trauma
Die Frührehabilitation wird bei Menschen mit schweren Hirnverletzungen bereits im Krankenhaus begonnen. Sie umfasst physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische Maßnahmen, die an den Zustand der Patient*innen angepasst werden.
Rehabilitation: Inhalte und Ziele

Nach einem mittelschweren oder schweren Schädel-Hirn-Trauma mit Gehirnschäden kommt es häufig zu Einschränkungen, die das selbstständige Leben, die Teilhabe am Alltag und die Lebensqualität stark beeinflussen.
Sind die akuten Behandlungen abgeschlossen, schließt sich eine neurologische Rehabilitation an. Dort werden die Folgen der Hirnverletzung gezielt behandelt, um Fähigkeiten wieder aufzubauen und den Alltag bestmöglich zu erleichtern. Ziel der neurologischen Rehabilitation nach einem Schädel-Hirn-Trauma ist es, die Folgen der Hirnverletzung bestmöglich auszugleichen. Da geschädigtes Gehirngewebe sich nicht erneuert, wird das noch gesunde Gewebe gezielt trainiert, um verlorene Funktionen zu übernehmen.
Die Behandlung fördert Körper, Geist, Denken und Gefühle gleichermaßen. So sollen Selbstständigkeit und Lebensqualität umfassend verbessert werden. Außerdem unterstützt die Reha die Patient*innen dabei, wieder in ihr privates, familiäres, soziales und berufliches Leben zurückzufinden.

Die neurologische Rehabilitation ist nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma unverzichtbar – sie gibt vielen Betroffenen die Chance, Schritt für Schritt in ihren Alltag zurückzufinden.
Dr. med. Petra Mummel, ärztliche Direktorin, Chefärztin der Klinik für Akutneurologie und Neurologische Frührehabilitation der MEDICLIN Hedon Klinik
Phasen der neurologischen Rehabilitation
Phase A – Akutversorgung
Bei einem Schädel-Hirn-Trauma wird der*die Patient*in direkt nach dem Unfall bzw. der Verletzung im Akutkrankenhaus behandelt.
Phase B – Frührehabilitation
Noch im Krankenhaus beginnt die Frührehabilitation. Hier erhalten Patient*innen neben der Intensivpflege eine aktivierende Pflege und erste Therapien, um verlorene Fähigkeiten wiederzuerlangen. Sobald keine akute Behandlung mehr nötig ist, sollte die Frührehabilitation in einer spezialisierten Fachklinik fortgeführt werden.

Phase C – Weiterführende Rehabilitation
In dieser Phase können Betroffene aktiv an den Therapien mitarbeiten. Ziel ist es, wieder mobil zu werden und den Alltag schrittweise selbstständiger zu bewältigen, während weiterhin ärztliche und pflegerische Unterstützung erfolgt.
Phase D – Anschlussrehabilitation (AHB/AR)
Jetzt steht die Rückkehr in den Alltag und, wenn möglich, in den Beruf im Mittelpunkt. Patient*innen werden zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Wenn nötig werden individuelle Hilfsmittel wie Rollatoren oder Gehhilfen angepasst und der Umgang damit geübt. Mit Phase D endet die medizinische Reha. Voraussetzung: Die Patient*innen sind weitgehend mobil und benötigen kaum pflegerische Hilfe.
Phase E – Nachsorge und berufliche Rehabilitation
Hier geht es um den langfristigen Wiedereinstieg ins Berufsleben, zum Beispiel durch Anpassung des Arbeitsplatzes oder Umschulungen. Diese Phase sichert den Reha-Erfolg auf Dauer.
Phase F – Aktivierende Langzeitpflege
Wenn trotz aller Therapien eine dauerhafte Pflege notwendig bleibt, erhalten Betroffene in Phase F eine aktivierende Langzeitpflege und umfassende Betreuung.
Was in der Rehabilitation passiert: Ablauf und Inhalte
Die Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas können sehr unterschiedlich sein und auch andere Körperfunktionen und Organe betreffen. Deshalb arbeiten in der neurologischen Rehabilitation Fachärzt*innen für Neurologie gemeinsam mit Ärzt*innen anderer Fachrichtungen, Psycholog*innen, Pflegekräften, Logopäd*innen, Ergo- und Physiotherapeut*innen, Therapeut*innen der physikalischen Therapie sowie Sozialarbeiter*innen in einem multiprofessionellen Team zusammen.
Um die Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas bestmöglich zu behandeln, umfasst die neurologische Reha verschiedene Therapiemodule:
- Das ärztliche Team sorgt dafür, dass Sie medizinisch rundum versorgt sind.
- Die medikamentöse Therapie wird regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf geändert.
- Die Behandlungen werden laufend an Ihren Therapiefortschritt angepasst.
- Falls Sie Pflege benötigen, werden Sie von Fachpersonal individuell betreut.
- Mit der Sport- und Bewegungstherapie durch spezifisch ausgebildete Physiotherapeut*innen bauen Sie Kraft und Kondition auf und verbessern Ihre Koordination, Balance und Beweglichkeit. Sie werden wieder mobiler und stärken Ihre allgemeine Gesundheit.
- In der Ergotherapie trainieren Sie Ihre Feinmotorik und alle Fähigkeiten, die Sie im Alltag und möglicherweise auch im Beruf benötigen.
- Bei Sprach- und Sprechstörungen infolge eines Schädel-Hirn-Traumas führen Logopäd*innen mit Ihnen spezielle Übungen in Einzel- und/oder Gruppentherapie durch. Ziel ist es, Ihre Sprachfähigkeiten wiederherzustellen oder zu erhalten. Schluckstörungen werden ebenfalls logopädisch behandelt.
- Kognitives Training trainiert Ihre Gedächtnisleistung, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Konzentration. Spezielle Übungen unterstützen Sie dabei, alltägliche oder berufliche Probleme zu lösen.
- Psychologisch geschultes Personal hilft Ihnen, die psychischen Belastungen infolge Ihres Schädel-Hirn-Traumas zu bewältigen.
- Der Sozialdienst steht Ihnen bei sozialen und finanziellen Fragen sowie der Organisation der häuslichen Pflege mit Rat und Tat zur Seite.
Experteninterview
Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas
Die Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas hängen davon ab, wie schwer die Verletzungen waren und welche Regionen im Gehirn geschädigt wurden.
Zu den Folgen gehören unter anderen:
- Kopfschmerzen
- Epilepsie
- Lähmungen
- Koordinationsstörungen
- Konzentrationsstörungen
- Gedächtnisprobleme
- Persönlichkeitsveränderungen, z. B. Aggressivität
- Depressionen
- Berufsunfähigkeit
- Verlust der Selbstständigkeit
- Pflegebedürftigkeit
- Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma
Wird man nach einem Schädel-Hirn-Trauma wieder ganz gesund?
Menschen mit leichtem Schädel-Hirn-Trauma werden in der Regel wieder gesund.
Bei schweren Verletzungen ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich kann abgestorbenes Hirngewebe nicht wiederhergestellt werden. Im medizinischen Sinne ist daher eine vollständige Heilung des Gewebes nicht mehr möglich.
Das verbliebene gesunde Gehirn kann jedoch teilweise Aufgaben und Funktionen des zerstörten Gewebes übernehmen. In der neurologischen Rehabilitation wird das verbliebene gesunde Gehirn gezielt dazu angeregt, die Funktionen und Fähigkeiten zu trainieren, die durch die Kopfverletzung verloren gegangen sind. Im besten Falle kann das gesunde Gehirn die Schädigungen funktionell ausgleichen.
Je schwerer die Hirnverletzungen sind, desto geringer sind jedoch die Chancen, dass die Gehirnfunktionen wieder vollständig hergestellt werden. Es ist dennoch wichtig, sich aktiv an der neurologischen Rehabilitation zu beteiligen. So können viele Beschwerden deutlich gemildert werden, was den Alltag erleichtert und die Lebensqualität verbessert.

Entscheidend für die Prognose nach einem Schädel-Hirn-Trauma sind zwei Faktoren: eine schnelle, optimal abgestimmte Notfallversorgung und eine frühzeitige, intensive Rehabilitation.
Dr. med. Petra Mummel, ärztliche Direktorin, Chefärztin der Klinik für Akutneurologie und Neurologische Frührehabilitation der MEDICLIN Hedon Klinik
Kann ein Schädel-Hirn-Trauma noch Jahre später Probleme verursachen?
Ein einmaliges, leichtes Schädel-Hirn-Trauma, das gut ausgeheilt ist, verursacht in der Regel keine Spätfolgen.
Menschen, die wiederholte leichte Schädel-Hirn-Traumata erlitten haben, haben ein erhöhtes Risiko für chronische neurologische Erkrankungen, wie z. B. Demenz oder Parkinson. Dieser Zusammenhang wurde bei Sportler*innen beobachtet, auf deren Kopf häufig Kräfte einwirken, wie z. B. Boxer*innen (Schläge auf den Kopf) oder Fußballer*innen (Kopfbälle).
Nach einmaligen mittelschweren oder schweren Schädel-Hirn-Traumata ist das Risiko für Demenz, Parkinson oder andere neurologische Krankheiten ebenfalls erhöht. Die Erkrankungen brechen bei den Betroffenen auch in jüngerem Alter aus als bei Menschen, die nie Kopfverletzungen hatten. Darüber hinaus können alle obengenannten Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas auch erst Jahre nach der Verletzung des Kopfes auftreten.

Unsere Expertin: Dr. med. Petra Mummel
Dieser Ratgebertext entstand in Zusammenarbeit mit Dr. med. Petra Mummel, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Akutneurologie und neurologische Frührehabilitation an der MEDICLIN Hedon Klinik in Lingen. Dr. Mummel verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung neurologischer Erkrankungen und ist besonders spezialisiert auf die Diagnostik und Rehabilitation nach Hirnverletzungen und Schädel-Hirn-Trauma.